
UN-Hungerbericht: Hilfswerke und Bundesregierung fordern mehr Einsatz
Rom/Berlin/Aachen ‐ Global ist die Zahl der Hungernden leicht gesunken, aber regional gibt es gegenläufige Trends. Jüngste Kürzungen von Geberstaaten sind noch nicht eingepreist. Hilfswerke sehen daher keinen Grund für Entwarnung.
Aktualisiert: 29.07.2025
Lesedauer:
In Reaktion auf einen neuen UN-Bericht zur globalen Ernährungssicherheit haben Bundesregierung und Hilfsorganisationen mehr Einsatz für Notleidende gefordert. Weltweit litten „unerträglich viele Menschen an Hunger“; dies sei „inakzeptabel in einer Welt, in der es eigentlich genug Essen für alle gibt“, erklärte Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) am Montag in Berlin.
Laut dem Bericht „The State of Food Security and Nutrition in the World“ (SOFI), den fünf UN-Fachorganisationen am Montag in Rom vorgestellt hatten 638 bis 720 Millionen Menschen im vergangenen Jahr nicht genug zu essen, obwohl weltweit genug Lebensmittel produziert wurden. Der mittlere Schätzwert von 673 Millionen chronisch Unterernährten liegt global betrachtet 15 Millionen niedriger als im Vorjahr. Im Gegensatz zu einer positiven Entwicklung in Regionen wie Südasien und Lateinamerika stiegen die Zahlen jedoch in Afrika und Westasien.
Hilfsorganisationen in Deutschland hatten vergangene Woche eigene Jahresberichte veröffentlicht und dabei auf Grundlage älterer Daten höhere Schätzungen für die Gesamtzahl der Hungernden genannt.
Während die Quote der Unterernährten in Asien auf 6,7 Prozent und in Lateinamerika auf 5,1 Prozent sank, hungerte in Afrika im vergangenen Jahr jeder Fünfte – insgesamt 307 Millionen Menschen. In Europa und Nordamerika wird die Unterernährung mit unter 2,5 Prozent angegeben. Im globalen Schnitt beträgt sie 8,2 Prozent.
Weit entfernt vom 2030-Ziel
Der Bericht zeichnet ernüchternde Aussichten für das Ziel der Staatengemeinschaft, den Hunger bis 2030 weltweit zu beenden. Nach der aktuellen Projektion würden dann noch immer 512 Millionen Menschen hungern, davon allein 300 Millionen in Afrika. Keine Fortschritte sind auch beim Kampf gegen Übergewichtigkeit oder Auszehrung von Kindern erkennbar.
Als eine wesentliche Ursache für den Hunger nennt der Bericht eine seit der Corona-Pandemie überproportional hohe Inflation bei Lebensmittelpreisen, besonders in Entwicklungsländern. Er empfiehlt steuer- und geldmarktpolitische Gegenmaßnahmen im Verbund mit Sozialprogrammen und Investitionen in Agrarforschung, Transport- und Produktionsinfrastruktur sowie Marktinformationssysteme.
Zu Einzelaspekten des Berichts gehört, dass die größte Verteuerung bei Grundnahrungsmitteln zu verzeichnen war, die die Haupternährungsquelle für arme Bevölkerungsgruppen darstellen, etwa in Mexiko, Nigeria oder Pakistan. Auch soziale Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts oder starker Einkommensunterschiede wirkten sich auf die Ernährungssicherheit aus. In ländlichen Regionen lag der Anteil der Hungernden deutlich höher als in Städten. Die höchsten Kosten für eine gesunde Ernährung müssen Menschen in Ostasien, Südamerika und Nordafrika zahlen. Am billigsten ist sie in Westeuropa.
Hunger als Waffe
Das katholische Hilfswerk Misereor sieht mit Blick auf die anhaltenden hohen Zahlen dabei nicht nur Finanzierungs- und Verteilungsprobleme. 673 Millionen Menschen hungerten nicht, weil die Welt sie nicht ernähren könnte, so Lutz Depenbusch, Misereor-Experte für Ernährung. Konfliktparteien – in Gaza, Myanmar, dem Sudan und vielen anderen Ländern – nähmen Hunger in Kauf oder setzten ihn gezielt als Waffe ein. „Regierungen ignorieren die Armut, die Menschen in den Hunger treibt. Sie ignorieren die unzureichenden Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe, die schon heute Ernten und Leben vernichtet“, erklärt Depenbusch. Nicht zuletzt der Politikwechsel in den USA drohe die Lage nochmals zu verschärfen.
Auch die deutsche Bundesregierung nimmt Ernährungs-Experte Depenbusch in die Pflicht. Diese könne zwar den Hunger nicht allein beenden, aber einen wichtigen Beitrag leisten. „Sie sollte gegenüber Kriegsparteien klar Position beziehen – auch mit Blick auf Gaza. Sie sollte die Bekämpfung des Klimawandels verstärken und nicht zugunsten kurzfristiger Wirtschaftsinteressen abschwächen. Und vor allem sollte sie ihre – nach dem Rückzug der USA – noch wichtigere Rolle in der internationalen Zusammenarbeit aktiv annehmen.“ Setze die Regierung allerdings ihre Pläne um, die Entwicklungsarbeit weiter zu kürzen nehme sie Leid und Sterben sehenden Auges in Kauf.
Kritisch zur Hunger-Bilanz äußerte sich auch der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Mathias Mogge. Zwar sei es ermutigend, dass die neuen Hungerzahlen etwas niedriger waren als im vorigen Jahr, jedoch verdeckten globale oder regionale Durchschnittswerte oftmals die Realität vor Ort. Während etwa in Indien Programme zur Ernährungssicherheit und sozialen Absicherung griffen, fehle es in anderen Teilen der Welt „entweder am politischen Willen oder die staatlichen Strukturen sind zu fragil, um vergleichbare Fortschritte zu erzielen“
Der Ernährungsbericht der Vereinten Nationen erscheint jährlich im Juli. Herausgegeben wird er von der UN-Ernährungsorganisation FAO, dem Internationalen Agrar-Entwicklungsfonds IFAD, dem Kinderhilfswerk Unicef und dem Welternährungsprogramm WFP sowie der Weltgesundheitsorganisation WHO.
Kompletten Bericht lesen/herunterladen
KNA/weltkirche.de/Misereor /dr

Bericht: Klimagefahren belasten arme Menschen besonders

Papst klagt Weltwirtschaftssystem wegen Hunger an

Missio-Chef Huber mahnt Hilfe für vergessene Krisenregionen an

Misereor: Ernährungsarmut seit 2017 auf dem Vormarsch
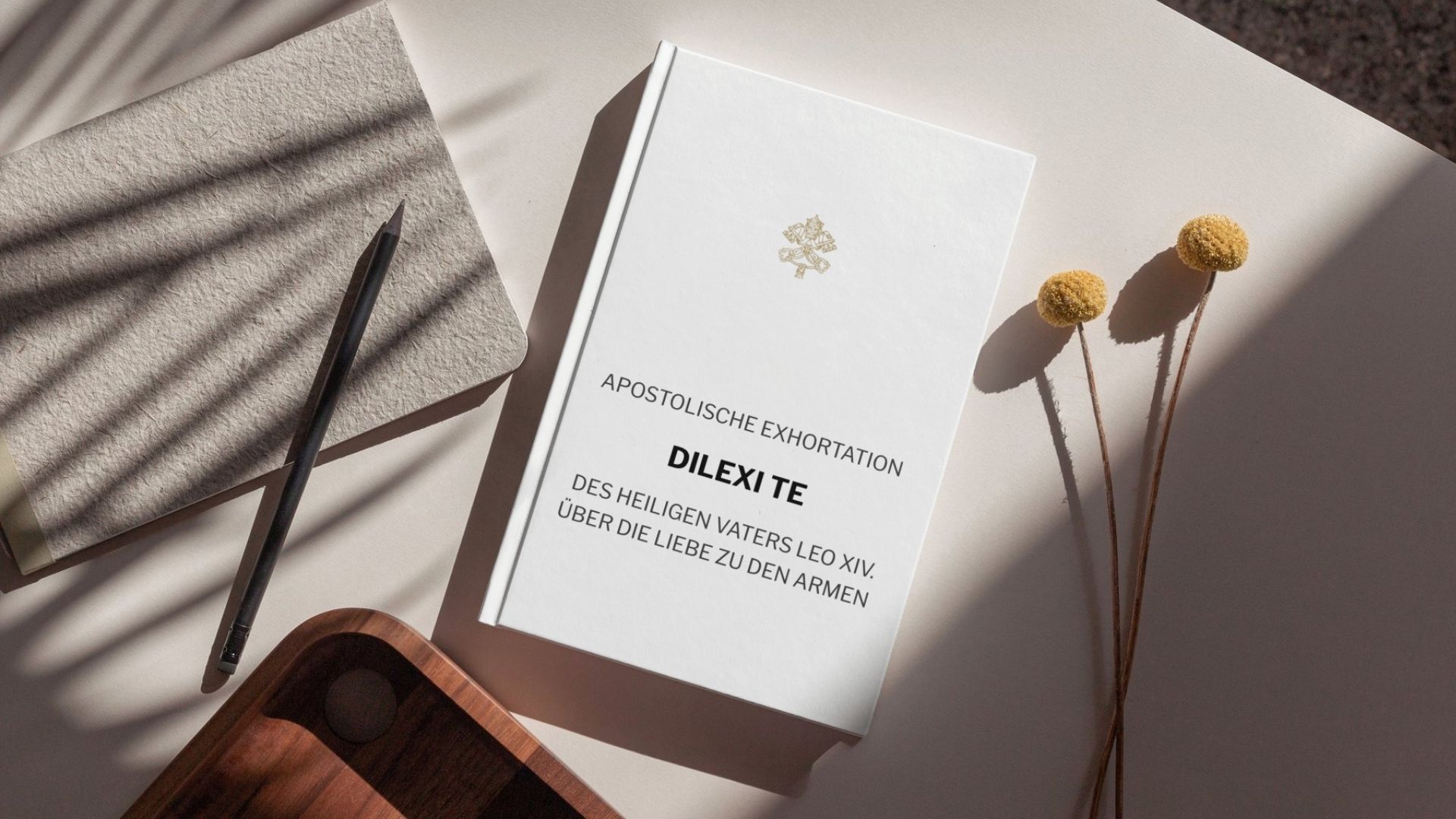
Der Papst aus Chicago und seine Kritik am Kapitalismus

„Dilexi te“: Papst Leo XIV veröffentlicht erstes Lehrschreiben

Misereor-Expertin zu Agenda 2030: „Der Countdown läuft“

UN-Hungerbericht: Hilfswerke und Bundesregierung fordern mehr Einsatz

