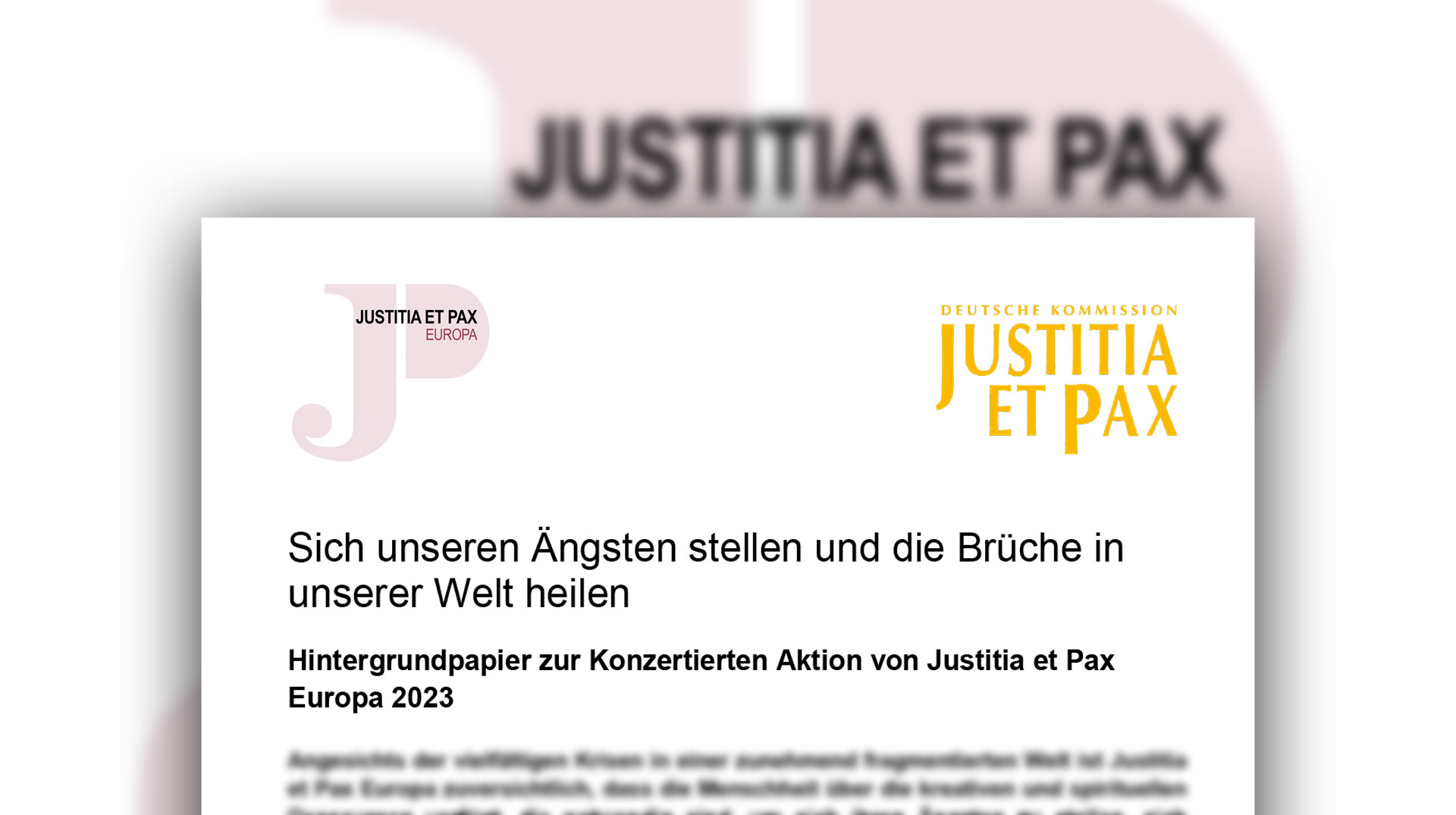Menschenrechtler und Bischöfe: Nicht vorschnell von Versöhnung reden
Können Ukrainer und Russen derzeit über Frieden und Versöhnung sprechen? Reden Kirchen davon nicht oft zu schnell? Ein ökumenisches Friedensgespräch in Münster hat sich der Frage angenommen.
Aktualisiert: 24.10.2025
Lesedauer:
Im Ukrainekrieg ist nach Ansicht des ukrainischen Menschenrechtlers Myroslav Marynovych derzeit keine politische Voraussetzung gegeben, über Frieden und Versöhnung zu sprechen. „Wir haben Angst vor einem Trump-Putin-Pakt wie vor dem Molotow-Ribbentrop-Pakt“, mit dem 1939 die Aufteilung Polens beschlossen wurde, sagte er bei einem ökumenischen Friedensgespräch in Münster am Donnerstagabend. Die bisherige Entwicklung in Tschetschenien, Georgien und der Ukraine zeige, dass Putin Europas Zurückhaltung und Deeskalation als Aufmunterung zu weiterer Gewalt interpretiere.
Die russische Menschenrechtlerin und Dissidentin Irina Scherbakowa teilte den Standpunkt von Marynovych. Derzeit sei nicht einmal ein Waffenstillstand in Sicht. Mit Blick auf die Aussöhnung zwischen Deutschland und seinen Nachbarn nach 1945 warnte sie: „Der Ukrainekrieg ist viel tragischer, denn in Russland und der Ukraine geht der Riss oft durch die Familien.“ Voraussetzung für Versöhnung sei ein gerechter Friede, in dem nicht nur besetzte Gebiete geräumt werden, sondern Verbrechen benannt und Verantwortliche in einem internationalen Tribunal zur Rechenschaft gezogen würden.
Der von der evangelischen und katholischen Kirche organisierte Abend solle konkret von Möglichkeiten der Versöhnung sprechen, erhoffte sich Moderator Jörg Lüer von der katholischen Kommission Justitia et Pax. Zu oft sei kirchliche Rede von Frieden und Versöhnung abstrakt, nett, harmlos und auch Opfer verhöhnend.
Landesbischof Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, teilte die politischen Einschätzungen. Dennoch müssten Christen einen weiteren Horizont aufmachen und Hoffnung auf Frieden, Wahrheit und Versöhnung wachhalten. Ein konkreter Schritt könne etwa sein, für den Fall eines Waffenstillstands kirchliche Infrastrukturen wieder aufzubauen, um Möglichkeiten für Gespräche und Hilfe zu bieten. Insgesamt brauche es einen sehr langen Atem. Denn letztlich sei den Menschen „Friedenssehnsucht ins Herz gepflanzt, auch wenn manche krankhaft nach Gewalt suchen“.
Erzbischof Udo Markus Bentz, Vorsitzender der katholischen Kommission Justitia et Pax, warnte, vor Frieden und Versöhnung brauche es Stabilität und Sicherheit. „Wir müssen erst einmal sehen, dass die Kampfparteien auseinandergehen“, so Bentz. Im Gaza-Krieg habe er erlebt, dass Waffenruhe und Geiselrückgabe erst möglich waren, als Mächte hinter den Kriegsparteien diese unter Druck setzten. Allerdings sehe auch er momentan keine Kraft, die den russischen Aggressor entsprechend vom Kampffeld zurückziehen könne.
Am Ende zeigte sich der ukrainische Menschenrechtler Marynovych dennoch zuversichtlich: „Ich rieche bereits das Ende des Regimes in Moskau, wir wissen nur nicht wann das sein wird.“ Allerdings verlange dies von vielen Seiten gewaltige Anstrengungen und Ausdauer. Und auch sein Land dürfe am Ende nicht in Rachegelüste und pauschale Schuldvorwürfe verfallen.
KNA
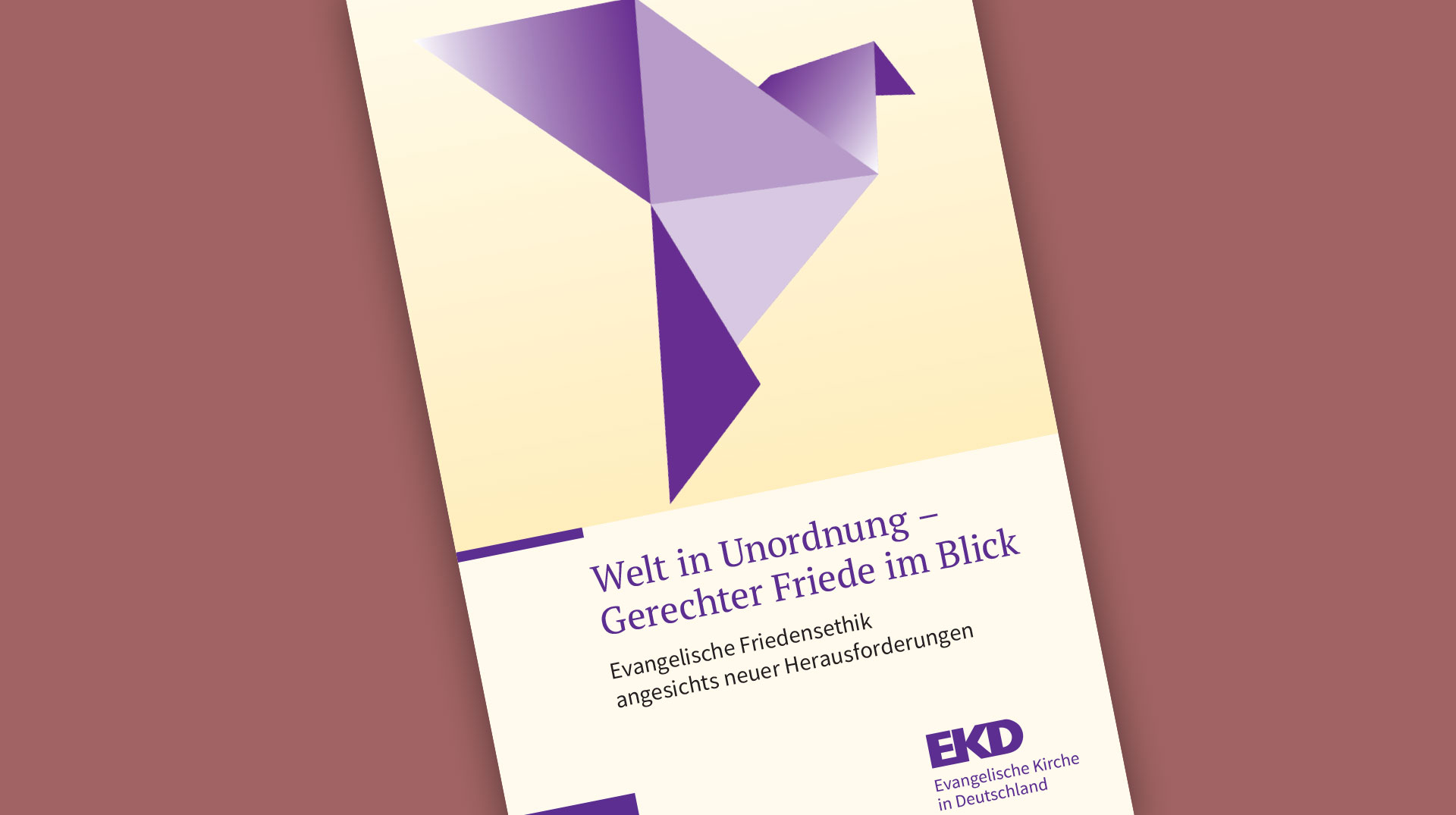
Evangelische Kirche positioniert sich friedensethisch neu

Menschenrechtler und Bischöfe: Nicht vorschnell von Versöhnung reden

Katholikenkomitee fordert Verteidigung der Demokratie in Europa

Kirchenleute und Experten debattieren über Friedenswort der Bischöfe

EKD-Ratsvorsitzende Fehrs: Friedensethik braucht Aktualisierung

Papst: Nicht von Kriegswaffen faszinieren lassen

Forscher Marc von Boemcken: Mit Russland im Gespräch bleiben

Rüstungs- und Friedenspolitik auf dem Kirchentagspodium

Rotkreuz-Präsidentin: Entwicklung von Kriegs-KI eindämmen

Bischof Wilmer mahnt zum Einsatz gegen Rekrutierung von Kindern