
Ökonom Dasgupta will die Natur als Kapital begreifen
Bonn ‐ Der Cambridge-Wissenschaftler Partha Dasgupta mahnt: Wer Natur zerstört, zerstört Wohlstand. In seinem Buch „Der Wert der Natur“ fordert er ein radikales Umdenken – und zwar mit der Natur statt gegen sie.
Aktualisiert: 23.09.2025
Lesedauer:
Noch nie war die Welt so wohlhabend wie heute. Das globale Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen Jahrzehnten explodiert, Millionen Menschen konnten der Armut entkommen. Doch dieser Fortschritt sei trügerisch, warnt der britisch-indische Ökonom Partha Dasgupta eindringlich. Zwar haben wir Wolkenkratzer und Autobahnen in aller Welt, sagt er; doch die andere Seite der Medaille seien ausgetrockneten Seen, ein unberechenbares Klima, abgeholzte Wälder und sterbende Korallenriffe.
Der Wirtschaftswissenschaftler, emeritierter Professor an der Universität Cambridge, ist einer der weltweit führenden Umweltökonomen. Dasguptas jetzt erschienenes Buch „Der Wert der Natur“ ist ein Manifest für eine Wirtschaft, die die Lebensgrundlagen für Mensch und Tier nicht länger zerstört. Seine zentrale These: Wir müssen die Natur endlich als Kapital begreifen so wie Gebäude, Maschinen oder Infrastruktur.
Bislang sei die Natur in ökonomischen Modellen kaum berücksichtigt worden, kritisiert der Umweltökonom Dasgupta. Das Bruttoinlandsprodukt, gängiges Maß für Wohlstand, blende aus, wie sehr die Menschen die Substanz der Lebensgrundlagen aufzehren. Der Ökonom fordert deshalb, das Maß für Wohlstand zu überdenken.
Er schlägt einen Wohlstandsindex vor, der nicht nur Sachkapital wie etwa Gebäude, Maschinen oder Infrastruktur und Humankapital berücksichtigt, also Gesundheit, Bildung und Wissen, sondern ebenso das Naturkapital. Dazu gehören die Regenerationsfähigkeit von Böden und Gewässern, Stabilität von Klimasystemen oder Artenvielfalt. Erst ein solcher umfassender Index bilde ab, ob eine Gesellschaft tatsächlich nachhaltig lebt, so Dasgupta.
Ein zentraler Punkt seines Manifests lautet daher: Kostenwahrheit schaffen. Wer Wälder rodet, Fischbestände übernutzt oder Kohlendioxid emittiert, verursacht Schäden, die bislang auf die Allgemeinheit oder künftige Generationen abgewälzt werden. Künftig müssten diese Kosten eingepreist werden, etwa über Abgaben, Steuern oder Quoten, fordert der Autor. Nur wenn die Nutzung von Natur einen Preis habe, werde der Anreiz entstehen, sorgsamer mit ihr umzugehen.
Wohlstand mit Natur denken
Dasgupta macht deutlich, dass Ökosysteme nicht nur schön sind; sie sind auch ökonomisch unverzichtbar. Als ein Beispiel nennt er die Mangrovenwälder. Sie schützen Küsten vor Sturmfluten, dienen als Kinderstube für Fische, liefern Holz und Honig und speichern zugleich enorme Mengen Kohlenstoff. Dennoch werden sie vielerorts gerodet, weil kurzfristige Gewinne locken. Ihre Zerstörung sei ein ökonomischer Irrweg, kritisiert Dasgupta.
Besonders betroffen sind die Armen, deren Überleben unmittelbar von intakten Ökosystemen abhängt, stellt der Umweltökonom fest. Für Bauern in Afrika südlich der Sahara entscheide die Zuverlässigkeit von Regenfällen über ihr Überleben, während Küstengemeinden in Bangladesch ohne den Schutz von Mangroven nahezu schutzlos Stürmen ausgesetzt seien. Er fordert also, dass internationale Abkommen so gestaltet werden müssen, dass sie die Schwächsten schützen.
Politische Maßnahmen allein reichen nach Ansicht von Dasgupta nicht aus. Auch der Konsum- und Lebensstil der Menschen müsse sich ändern. Damit nachhaltiges Verhalten nicht die Ausnahme bleibt, sieht der Wissenschaftler die Notwendigkeit von Anreizen und Rahmenbedingungen, die es erleichtern, umweltfreundliche Entscheidungen zu treffen. Dazu gehören nach seiner Meinung eine Bildung, die Sensibilität für ökologische Zusammenhänge schafft, aber auch Regeln, die umweltschädliches Verhalten unattraktiv machen. Märkte und Politik müssten so gestaltet werden, dass sie nachhaltiges Handeln belohnen.
Wohlstand dürfe nicht länger gegen die Natur definiert werden, fordert Partha Dasgupta, sondern müsse mit ihr gedacht werden. Seinen Leserinnen und Lesern gibt er mit auf den Weg: Wenn wir die Natur als Kapital anerkennen und ihre Leistungen in unser ökonomisches Handeln einbeziehen, dann können wir einen Weg aus der ökologischen Krise finden.
Schutz von Ökosystemen sei also nicht nur eine ethische Pflicht, sondern auch eine ökonomische Notwendigkeit. Wer Naturkapital zerstört, so Dasgupta, zerstört langfristig auch die Grundlagen des Wohlstands. Wer es hingegen erhält, schaffe Sicherheit, Gesundheit und Zukunft.
Partha Dasgupta: Der Wert der Natur – Manifest für eine Ökonomie, die unsere Welt nicht zerstört; aus dem Englischen von Jürgen Neubauer, Siedler Verlag, München 2025, 288 S., 26 Euro.
Laudato si' und der Wert von Natur und Umwelt
In seiner Enzyklika Laudato si' äußerte sich Papst Franziskus wiederholt zum Wert von Natur und Umwelt:
„32. Die Ressourcen der Erde werden auch geplündert durch ein Verständnis der Wirtschaft und der kommerziellen und produktiven Tätigkeit, das ausschließlich das unmittelbare Ergebnis im Auge hat. Der Verlust von Wildnissen und Wäldern bringt zugleich den Verlust von Arten mit sich, die in Zukunft äußerst wichtige Ressourcen darstellen könnten, nicht nur für die Ernährung, sondern auch für die Heilung von Krankheiten und für vielfältige Dienste. Die verschiedenen Arten enthalten Gene, die Ressourcen mit einer Schlüsselfunktion sein können, um in der Zukunft irgendeinem menschlichen Bedürfnis abzuhelfen oder um irgendein Umweltproblem zu lösen.
33. Doch es genügt nicht, an die verschiedenen Arten nur als eventuelle nutzbare ‚Ressourcen‘ zu denken und zu vergessen, dass sie einen Eigenwert besitzen. Jedes Jahr verschwinden Tausende Pflanzen- und Tierarten, die wir nicht mehr kennen können, die unsere Kinder nicht mehr sehen können, verloren für immer. Die weitaus größte Mehrheit stirbt aus Gründen aus, die mit irgendeinem menschlichen Tun zusammenhängen. Unseretwegen können bereits Tausende Arten nicht mehr mit ihrer Existenz Gott verherrlichen, noch uns ihre Botschaft vermitteln. Dazu haben wir kein Recht.
[...]
36. Die Pflege der Ökosysteme setzt einen Blick voraus, der über das Unmittelbare hinausgeht, denn wenn man nur nach einem schnellen und einfachen wirtschaftlichen Ertrag sucht, ist niemand wirklich an ihrem Schutz interessiert. Doch der Preis für die Schäden, die durch die egoistische Fahrlässigkeit verursacht werden, ist sehr viel höher als der wirtschaftliche Vorteil, den man erzielen kann. Im Fall des Verlustes oder des schweren Schadens an einigen Arten ist von Werten die Rede, die jedes Kalkül überschreiten. Darum können wir stumme Zeugen schwerster Ungerechtigkeiten werden, wenn der Anspruch erhoben wird, bedeutende Vorteile zu erzielen, indem man den Rest der Menschheit von heute und morgen die äußerst hohen Kosten der Umweltzerstörung bezahlen lässt.
[...,141., das Wirtschaftswachstum neigt] dazu, Automatismen zu erzeugen und zu ‚homogenisieren‘, mit dem Zweck, Abläufe zu vereinfachen und Kosten zu verringern. Daher ist eine Wirtschaftsökologie notwendig, die in der Lage ist, zu einer umfassenderen Betrachtung der Wirklichkeit zu verpflichten. Denn ‚damit eine nachhaltige Entwicklung zustande kommt, muss der Umweltschutz Bestandteil des Entwicklungsprozesses sein und darf nicht von diesem getrennt betrachtet werden‘“
Gleichzeitig betonte Papst Franziskus wiederholt, die natürlichen Ressourcen der Erde dürften nicht zu Spekulationsobjekten werden. Diesen Gedanken hatten zuletzt auch die Bischöfe aus Asien, Lateinamerika und Afrika in einem gemeinsamen Appell aufgegriffen:
„Zurückweisung der Finanzialisierung der Natur: Ökosysteme sind keine veräußerlichen ‚Umweltdienstleistungen‘, sondern vielmehr ein komplexes, vielschichtiges Zusammenspiel von belebter und unbelebter Natur sowohl menschlicher als auch nicht-menschlicher Art. All das ist Teil von Gottes Schöpfung, die unsere Fürsorge und unseren Respekt verlangt. Daher fordern wir, dass naturbasierte Lösungen von der Marktlogik aus genommen werden und ihr Ziel, den Klimawandel einzudämmen, die biologische Vielfalt wiederherzustellen und die Lebensgrundlagen der Menschen zu sichern, in den Vordergrund gestellt wird. In diesem Zusammenhang weisen wir Finanzialisierungsinitiativen wie Emissionszertifikate auf Basis von REDD+, freiwillige Kohlenstoffmärkte o. Ä. ab“
Auswahl: dr/weltkirche.de
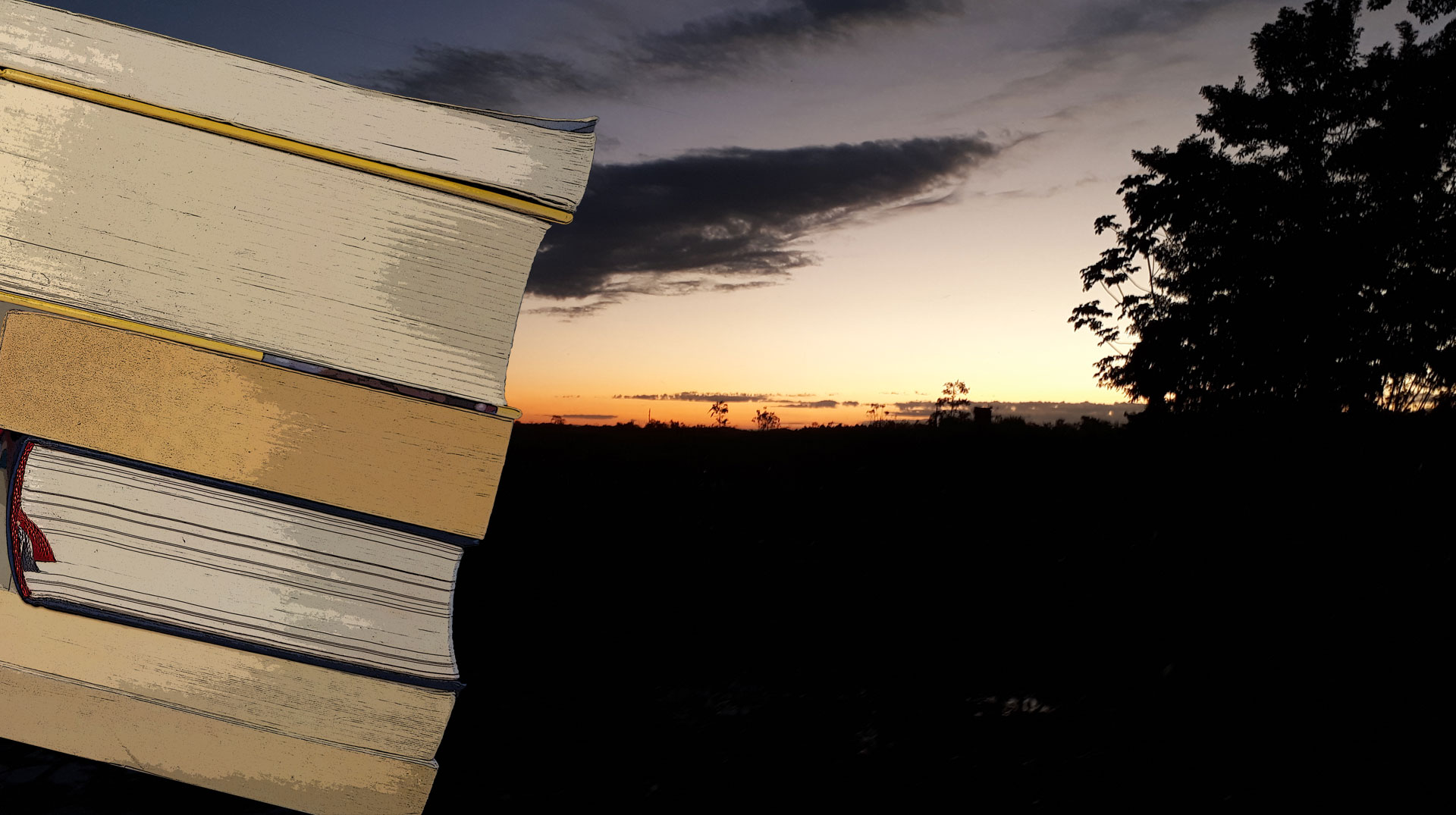
Ökonom Dasgupta will die Natur als Kapital begreifen

Papst Leo und Schwarzenegger kommen zu Klimakonferenz in Castel Gandolfo

Beten für unsere Erde, beten mit der Schöpfung

Umweltminister: Klimawandel ist größte soziale Frage unserer Zeit

Bereits am 24. Juli: Erdüberlastungstag 2025 eine Woche früher

Kirchen im Globalen Süden veröffentlichen Klima-Appell

Studie: Klimaschutz schafft Wirtschaftswachstum

Neues Netzwerk Eine Erde will gerechten Wandel vorantreiben

