
Der Gewalt nicht das letzte Wort lassen
Oświęcim/Berlin ‐ Konstruktiv über die Überwindung von Krieg und Gewalt sprechen: Bereits zum 16. Mal hat die Maximilian-Kolbe-Stiftung dazu Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt ins polnische Oświęcim geladen.
Aktualisiert: 03.09.2025
Lesedauer:
Vom 11. bis 16. August 2025 fand in Auschwitz der 16. Europäische Workshop der Maximilian-Kolbe-Stiftung zum Umgang mit der gewaltbelasteten Vergangenheit von Auschwitz statt. Unter dem Leitwort „Gemeinsam von Auschwitz lernen – Beziehungen konstruktiv gestalten“ kamen Menschen aus verschiedenen Teilen Europas sowie aus Namibia zusammen, um über Versöhnung und Dialog vor dem Hintergrund der derzeitigen Konflikte in Europa und globaler Instabilität zu diskutieren.
Nach Angaben der Organisatoren zielte das Programm darauf ab, durch die gemeinsame Auseinandersetzung mit der Geschichte von Auschwitz und den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs den 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Raum zu öffnen, in dem konstruktiv über die Überwindung von Krieg und Gewalt gesprochen wird. In einer Zeit, die von der Zunahme militärischer Auseinandersetzungen geprägt ist, wie etwa in der Ukraine und im Nahen Osten, bot der Workshop eine Plattform zur Debatte und des interkulturellen Verständnisses. Die Teilnehmenden kamen aus Polen, Deutschland, der Ukraine, Russland, Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Albanien, Bosnien-Herzegowina, Italien und Namibia. In den Diskussionen erwuchsen, heißt es in einer Pressemitteilung der Maximilian-Kolbe-Stiftung, eine Vielfalt an Perspektiven, auch bisweilen spannungsreiche, aber letztlich produktive Auseinandersetzungen. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine war in vielen Diskussionen Thema.
Die gemeinsame Basis, die es für eine konstruktive Konfliktbewältigung braucht, wurde bei Führungen durch die Gedenkstätte, Begegnungen mit Überlebenden sowie durch spirituelle Momente geschaffen. Dabei kam der Teilnahme an der Eucharistiefeier aus Anlass des 84. Todestags von Pater Maximilian Kolbe OFM eine wichtige Rolle zu. In einzelnen Arbeitseinheiten wurde dem Umgang mit Auschwitz und dem Zweiten Weltkrieg exemplarisch anhand von Polen, Deutschland, der Ukraine und Estland nachgegangen. Dabei galt es, die Vielschichtigkeit der Auswirkungen der Gewalt zu verstehen und sich der Komplexität der verschiedenen – oft sehr fragilen – Heilungs- und Wandlungsprozesse zu stellen.
Die bosniakischen Teilnehmenden unterstrichen während des Workshops die Bedeutung der Tatsache, dass Deutsche und Polen heute gemeinsam der Opfer der Verbrechen erinnern können. Dies sei ein großes Zeichen der Ermutigung, dass eines Tages auch in Bosnien ein neues geheiltes Zusammenleben gelingen könne. Die Teilnehmenden aus der Ukraine warnten eindrücklich davor, den Begriff der Versöhnung fahrlässig und vorschnell zu verwenden, da dies von den Menschen, die unter ungerechter Gewalt litten, nur als mangelnder Respekt vor ihren Wunden wahrgenommen werden könne. So bestätigte sich die programmatische Aussage der deutschen Bischöfe in ihrem Wort Friede diesem Haus im Jahr 2024: „Wer von Versöhnung sprechen will, darf von den Verletzungen und dem Unversöhnten nicht schweigen.“
Für das Selbstverständnis der Maximilian-Kolbe-Stiftung war es wichtig, auch die Rolle der Kirche in den Prozessen der Gewaltüberwindung und der Versöhnung zu reflektieren. Pfarrer Dr. Manfred Deselaers, seit mehr als 30 Jahren deutscher Seelsorger in Oświęcim/Auschwitz, führte in die Frage vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen ein. Selbstkritische Reflexion sowie eine treue und praktische Solidarität mit den Opfern von Gewalt seien unabdingbar, wolle man verhindern, dass sich der Begriff der Versöhnung entleert, so Pfarrer Deselaers.
Maximilian-Kolbe-Stiftung
Die Maximilian-Kolbe-Stiftung wurde 2007 mit Unterstützung der Polnischen und der Deutschen Bischofskonferenz gegründet. Ziel der katholischen Stiftung ist es, Beiträge zur Stärkung der kirchlichen Versöhnungsarbeit in Europa zu leisten und sich für Opfer von Unrecht und Gewalt zu engagieren. Der hl. Maximilian Kolbe gab 1941 sein Leben stellvertretend für einen Mithäftling im Konzentrationslager Auschwitz und setzte damit ein Zeichen, dass Hass und Gewalt nicht das letzte Wort haben.
weltkirche.de/DBK

Ökumenisches Friedensgebet 2026 lenkt den Blick auf Madagaskar
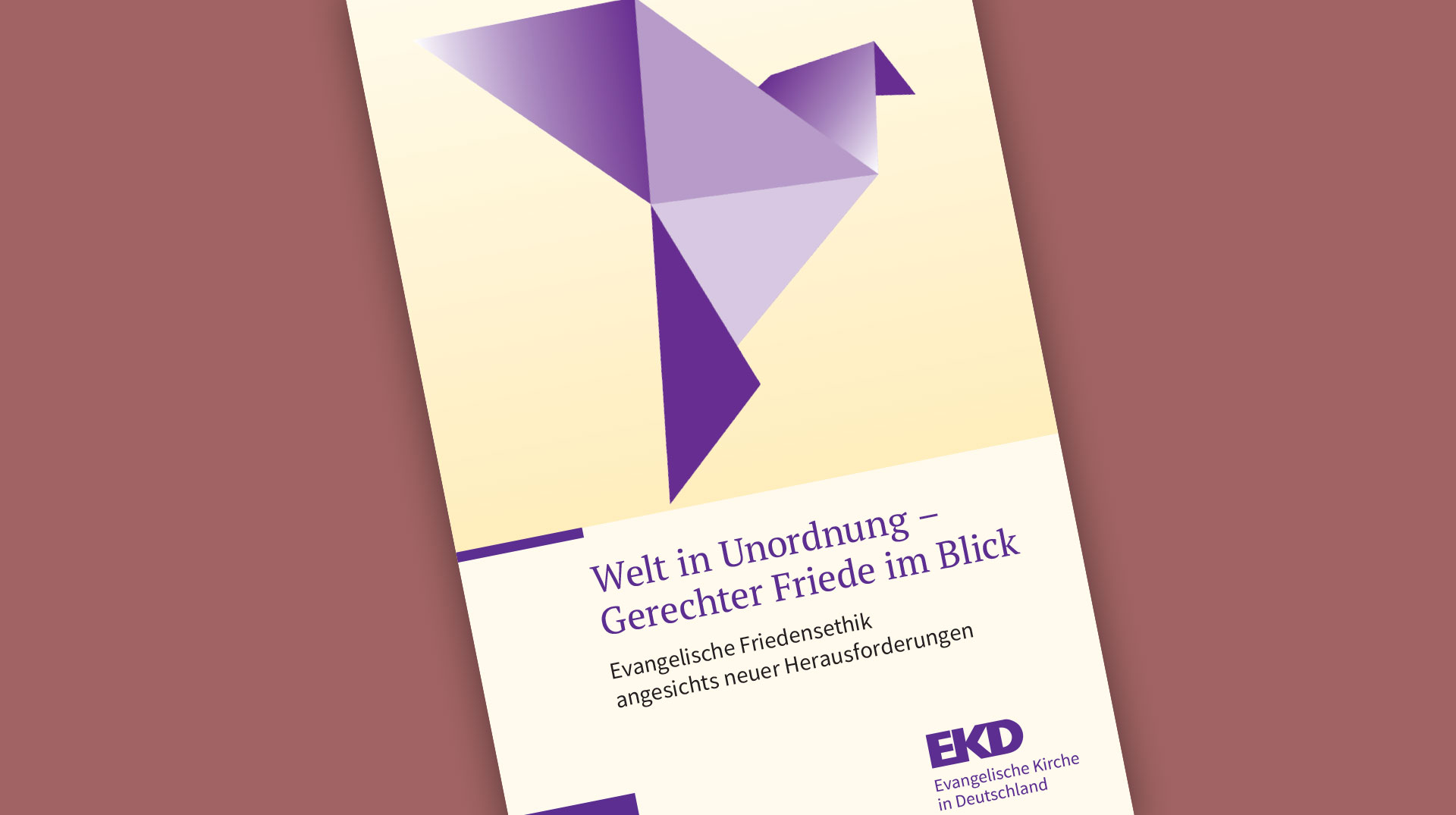
Evangelische Kirche positioniert sich friedensethisch neu

Bischöfe gedenken des historischen Versöhnungsbriefs von 1965

Menschenrechtler und Bischöfe: Nicht vorschnell von Versöhnung reden

Friedensnobelpreis geht an María Corina Machado
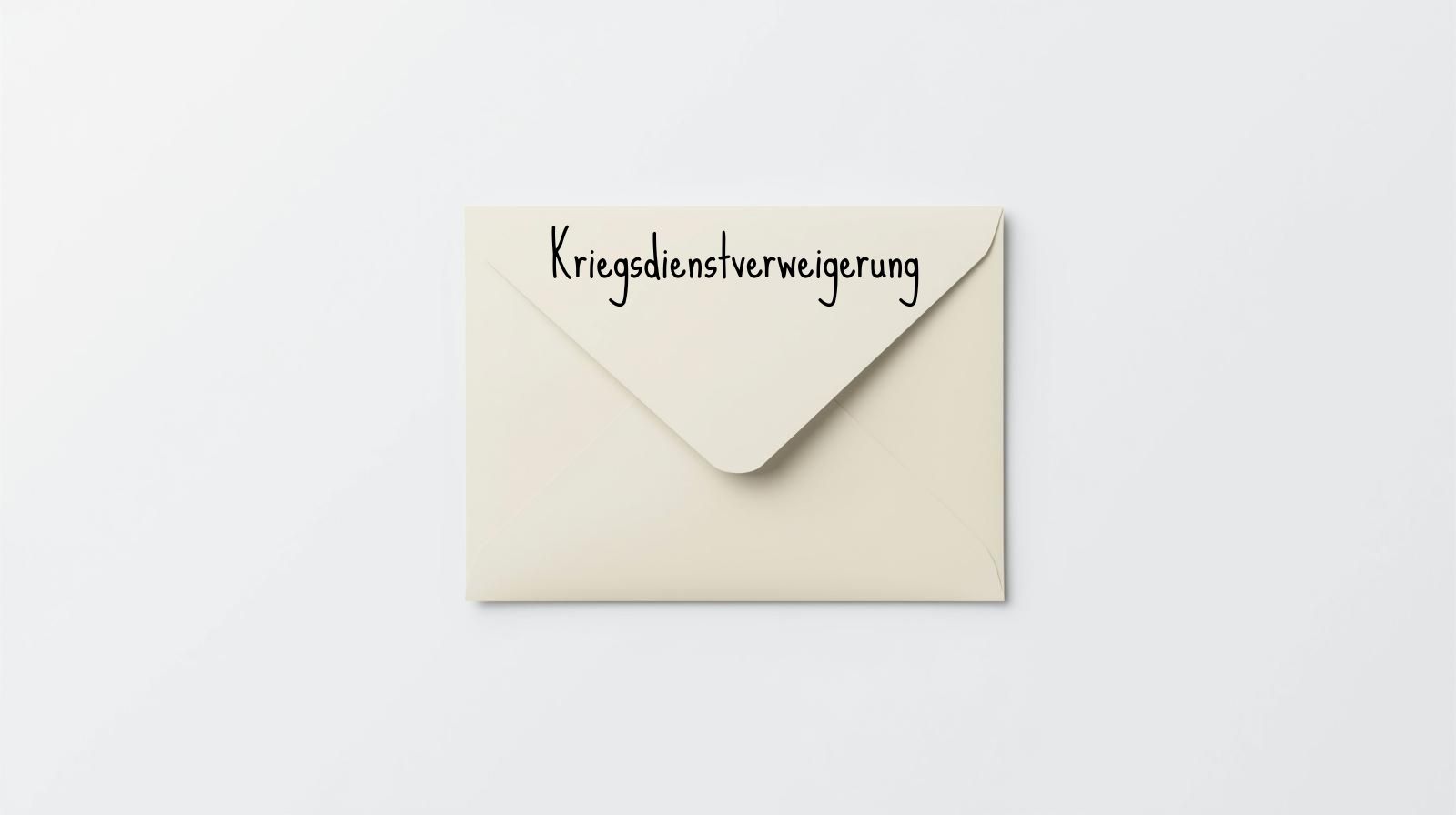
Evangelische Kirche richtet Beratungsnetz für Kriegsdienstverweigerer ein

60 Jahre deutsch-polnischer Briefwechsel: Kirchen erinnern an Auftrag zur Versöhnung

Katholikenkomitee fordert Verteidigung der Demokratie in Europa

